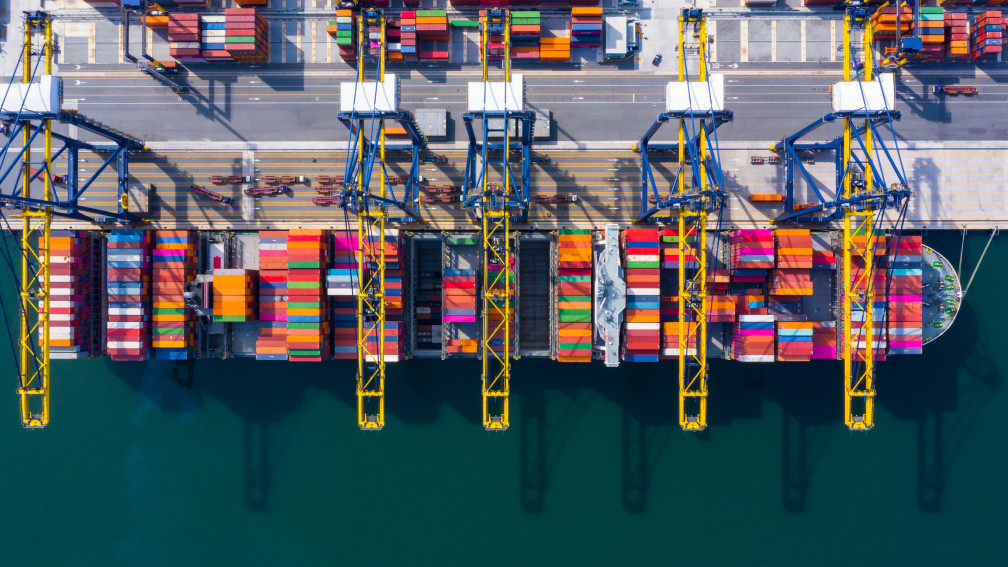Fünf Punkte für einen zielgerichteten Umgang mit der Nachhaltigkeitsregulierung
Die EU hat ihre Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung verschärft. Bereits Unternehmen ab 250 Mitarbeitenden und einer gewissen Schwelle bei Gewinn oder Umsatz müssen neu über eine breite Anzahl an Nachhaltigkeitsthemen berichten. Ausserdem muss die Berichterstattung zwingend durch eine externe Revisionsstelle überprüft werden. Weil das teuer und aufwändig ist, ist für die Schweizer Wirtschaft klar: Aufwand und Ertrag müssen stimmen. Die Schweiz tut gut daran, eine eigenständige Antwort auf die Entwicklungen in der EU zu finden. Fünf Punkte sind dafür zentral.
Vor dem Hintergrund der Entwicklungen in der EU wird die Schweiz sowohl im Bereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung (EU Richtlinie CSRD) wie auch im Bereich der verbindlichen Sorgfaltsprüfungspflichten (EU-Richtlinie CSDDD respektive EU-Lieferkettengesetz) angemessene Antworten finden müssen.
In der Schweiz müssen grosse Unternehmen des öffentlichen Interesses bereits heute verbindlich über ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten berichten. Darüber hinaus bestehen spezifische Sorgfaltsprüfungspflichten in den Bereichen Konfliktmineralien und Kinderarbeit. Hier gelten im Gegensatz zum EU-Recht keine Schwellenwerte. Letzten Herbst hat der Bundesrat die Eckwerte zur Weiterentwicklung der Schweizer Regulierung unter Berücksichtigung der Entwicklungen in der der EU definiert. Heute hat er die Vernehmlassung dazu eröffnet.
Fünf Punkte für eine praxistaugliche Nachhaltigkeitsregulierung
Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen ist es für die Schweizer Unternehmen wichtig, dass die Schweiz eine vernünftige Antwort findet, die im Firmenalltag umsetzbar ist. Dafür sind fünf Punkte zentral:
1. Wichtig ist ein international abgestimmtes Vorgehen
Die Schweizer Wirtschaft setzt sich dafür ein, dass Aufwand und Ertrag stimmen. Voreilige Massnahmen und regulatorische Experimente bergen für einen Kleinstaat wie die Schweiz die Gefahr, international den Anschluss zu verlieren. Die Schweiz soll in diesem Bereich deshalb keine Vorreiterrolle einnehmen.
2. KMU müssen entlastet oder ausgenommen werden
Es braucht wissenschaftliche Evidenz und konkrete Ziele, aber keine moralischen und industriepolitischen Prinzipien. Besonderes Augenmerk ist auf KMU zu legen: Diese sind mit geeigneten Massnahmen von Regulierungen auszunehmen oder so weit wie möglich zu entlasten.
3. Transparenz ist entscheidend
Transparenz ist eine Grundvoraussetzung für einen funktionierenden Markt. Nachhaltigkeitsaktivitäten der Unternehmen dürfen nicht durch überspitzte Bürokratie und reine Compliance-Übungen gelähmt werden. Gleichzeitig darf Transparenz nicht als Werkzeug für unbegründete Anschuldigungen in der Öffentlichkeit oder vor Gerichten («Greenbashing») missbraucht werden. Die Wirtschaft unterstützt derweil Bemühungen, dass die Markterwartungen an die Unternehmen nicht missbraucht werden. Dies ist gerade auch über das Lauterkeitsrecht möglich. Faire Regeln und die Vermeidung von Aktivismus sind wichtig, um nachhaltiges Handeln zu fördern.
4. Kosten müssen im Auge behalten werden – das bedingt Flexibilität
Die Schweiz muss international anerkannten Standards und Regulierungen offen gegenüberstehen. Unsere Unternehmen sind global tätig und in verschiedenen Rechtsräumen aktiv. Da sich Standards schnell entwickeln, ist Flexibilität grundlegend, damit den Unternehmen die Wahl offengelassen werden kann, welcher Standard für ihr Geschäftsfeld am besten geeignet ist. Eine ausschliessliche Orientierung an der EU-Regulierung ist dabei der falsche Weg. Stattdessen sollten Schweizer Unternehmen sich an globalen Standards wie z.B. GRI, ISSB oder TCFD orientieren können. Grundsätzlich muss eine Schweizer Regulierung daher betont prinzipienbasiert sein, da andere Märkte keinen vergleichbaren Ansatz wie die EU kennen.
5. Ohne Innovation gelingt es nicht
Innovation steht an erster Stelle für einen nachhaltigen Wandel. Gleichzeitig sollten Transparenzregeln und eine gesunde Marktwirtschaft Priorität haben, da sie eine dynamische Umgebung fördern und unternehmerische Initiative stärken. Politische Ziele sollten unter Berücksichtigung marktwirtschaftlicher Prinzipien umgesetzt werden. Erst wenn der Markt versagt, können Subventionen erwogen werden, wobei Industriepolitik und Verbote nur als allerletztes Mittel dienen dürfen.
economiesuisse wird sich auch in der weiteren Diskussion im engen Austausch mit den Mitgliedern einbringen und an der Vernehmlassung zur Berichterstattungspflicht entlang der fünf Punkte beteiligen.