10 Fragen zu (Erasmus)
27.04.2017
Downloads
Auf einen Blick
Sind die Türen bei Top-Unis wirklich zu? Können wir es nicht besser allein? 10 Fragen zu Erasmus klären auf.
1. Was ist passiert?
Studierende, Forschende und Politikerinnen und Politiker warteten lange darauf. Nun ist es passiert. Der Bundesrat hat heute (27. April 2017) entschieden, wie es mit der internationalen Mobilität im Bildungsbereich in den nächsten Jahren weitergeht, insbesondere dem europaweiten Studentenaustausch Erasmus+.

2. Was ist der Standpunkt des Bundesrats?
Erasmus+ sei zu teuer. Die Schweizer Übergangslösung genüge bis 2020.
3. Was sagen die Hochschulen?
Die Übergangslösung genüge langfristig nicht. Der Ausschluss berge Langzeitrisiken, Schweizer Studierende würden benachteiligt und unsere Hochschulen international immer mehr an Einfluss verlieren.
4. Von welchen Programmen reden wir?
Von Erasmus+. Zurzeit läuft ein autonomes Schweizer Ersatzprogramm, das bis Ende Jahr befristet ist.
-
(2011 bis 2013) Erasmus (Schweiz nahm direkt teil)
-
(2014 bis 2020) Erasmus+ (Schweiz ist nicht dabei)
-
(2020 bis 2027) Nachfolgeprogramm. Die Teilnahme der Schweiz am Nachfolgeprogramm dürfte aber durch die Kostenfrage kein Selbstläufer werden.
5. Sind die Türen bei den Top-Unis wirklich zu?
Ja. In Cambridge sind die Pforten seit 2014 für Schweizer Studierende generell verschlossen. Die altehrwürdige Bildungsstätte akzeptiert die Schweizer Erasmus-Übergangslösung nicht. Zu spüren bekommen hat dies etwa die ETH. «Cambridge will keine Austauschverträge abschliessen, die nicht dem Erasmus-Vertragsregelwerk entsprechen», bestätigt ETH-Sprecherin Franziska Schmid im Tagesanzeiger. Deshalb habe die Cambridge University 2014 den klassischen Austausch beendet.

Tatsache ist nämlich, dass verschiedene europäische Spitzenuniversitäten, beispielsweise auch Madrid, die Schweizer Hochschulen seit 2014 fallen liessen. Manche bieten keine Austauschplätze mehr an, andere weniger als früher. Die Folge: Hiesige Studierende, die ein Auslandsemester absolvieren wollen, müssen mit weniger renommierten oder weniger attraktiven Hochschulen vorliebnehmen.
6. Wieso haben wir das Problem überhaupt?
Wohl selbstverschuldet. Im Dezember 2013 begannen die Verhandlungen über die Beteiligung der Schweiz an Erasmus+. Doch die Gespräche wurden auf Eis gelegt, nachdem die Schweiz im Februar 2014 die Masseneinwanderungsinitiative angenommen hatte und sich vorerst weigerte, das Protokoll zur Ausdehnung der Personenfreizügigkeit auf Kroatien zu ratifizieren.

Rasch zeichnete sich ab, dass eine vollumfängliche Teilnahme unter diesen Voraussetzungen nicht möglich sein würde. Für 2014 beschloss der Bundesrat deshalb eine autonome Schweizer Ersatzlösung für Erasmus+, die seither immer wieder verlängert wurde.
Nachdem die Schweiz das Kroatien-Protokoll per Ende 2016 doch noch ratifiziert hat, wäre eine vollwertige Teilnahme an Erasmus+ prinzipiell wieder möglich. Für eine Assoziierung muss der Bundesrat die Verhandlungen mit der EU wieder aufnehmen und die Mittel für die Programmbeteiligung bereitstellen.
7. Können wir es nicht sowieso besser allein?
Ansichtssache. Es geht aber nur mit starken Einschränkungen und weniger Beteiligungsmöglichkeiten als mit Erasmus+. Der Bund bewilligte 2016 die Finanzierung für rund 4800 Studienaufenthalte im Ausland. Das waren deutlich mehr als in den Vorjahren. Eine Schweizer Erfolgsgeschichte also? Yves Flückiger, Rektor der Universität Genf, sagt im Tagesanzeiger: «Quantitativ konnte die studentische Mobilität erhalten bleiben, qualitativ leider nicht.»
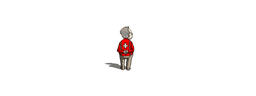
Das sind weitere Einschränkungen:
- Wie bereits zwischen 1996 und 2011 finanziert die Schweiz, was Mobilität angeht, fast alles wieder selbst.
- Zudem muss jede Hochschule den Austausch mit europäischen Partnern einzeln aushandeln, was einen immensen Aufwand bedingt. Im Fall der Universität Zürich handelt es sich um nicht weniger als 400 Einzelverträge.
- Die Teilnahme an Kooperationsprojekten ist stark eingeschränkt: Schweizer Institutionen können Projekte nicht koordinieren, weil die Schweiz nur den Status eines Drittlandes hat. Das ist für die Bildungslandschaft, aber auch für Jugendorganisationen deutlich schmerzhafter als die finanzielle Komponente.
Bildlich gesprochen hatten die Schweizer Studierenden bis 2013 quasi ein Generalabonnement für den europäischen Austausch. Jetzt stehen sie am Automaten Schlange und müssen jedes Billett einzeln aushandeln.
8. Erasmus+ und Erasmus, ist das nicht eh das Gleiche?
Nein. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern (Erasmus) umfasst dieses neue Programm auch aussereuropäische Aktivitäten und fördert neben der Mobilität der Lernenden auch verschiedene Arten von Kooperationsprojekten zwischen Bildungsinstitutionen.

Erasmus+ ist ein EU-Programm für Bildung und Mobilität. Unter dem Namen Erasmus+ richtet es sich an Schüler, an Lehrlinge, an Praktikanten, an Unternehmer und an erwachsene Lernende, die ohne bürokratische Hürden einen Aufenthalt an einer ausländischen Hochschule absolvieren können. Dazu kommen Förderaktivitäten, die mit dem schweizerischen Jugend + Sport vergleichbar sind. Das Programm ist auf sieben Jahre befristet, es startete 2014 und endet 2020.
9. Was bringt ein solcher Austausch überhaupt?
Für die Studierenden mehr Chancen. Studien beweisen, dass die in einem Austauschjahr erworbenen Fähigkeiten für den Erfolg in der Arbeitswelt äusserst wertvoll sind. Europaweit haben Studierende, die an Erasmus+ teilnehmen, ein um 50 Prozent tieferes Risiko, ein Jahr nach ihrem Abschluss noch arbeitslos zu sein.

Für die Bildungsinstitutionen selbst schafft Erasmus+ wertvolle Synergien, indem ihnen das Programm erleichtert, mit europäischen Partnern grenzüberschreitende Projekte durchzuführen. Sie erarbeiten gemeinsame Kursmodule, bilden europaweite Netzwerke, tauschen Erfahrungen aus und können so voneinander profitieren.

10. Wie ging es uns denn vor alldem?
Die Schweiz hat sich seit den frühen 1990er-Jahren aktiv an den europäischen Bildungs- und Jugendprogrammen beteiligt, bevor das EWR-Nein zu einem ersten Bruch führte.

Ab 1996 war nur noch eine indirekte Teilnahme möglich. Konkret: Die Schweiz musste einen grossen Teil der Kosten selbst tragen, und die Möglichkeiten, an Kooperationsprojekten zu partizipieren, waren für hiesige Bildungsinstitutionen stark begrenzt. Auch an den Programmen für die Jahre 2007 bis 2013 war die Schweiz zunächst nicht direkt beteiligt.
Erst 2009 konnte mit der EU in einer politischen Absichtserklärung die Teilnahme an den Programmen «Lebenslanges Lernen» und «Jugend in Aktion» vereinbart werden. Das entsprechende Abkommen trat im März 2011 in Kraft.
Erasmus (European community action scheme for the mobility of university students) ist ein Teil von «Lebenslanges Lernen». Andere Teilprogramme befassen sich mit Schulbildung (Comenius), Berufsbildung (Leonardo da Vinci) und Erwachsenenbildung (Grundtvig). Das Programm «Jugend in Aktion» deckt hingegen den Bereich der nicht formalen Bildung für junge Menschen ab, zum Beispiel Freiwilligenarbeit und Kooperationen zwischen Jugendorganisationen.
Von 2011 bis Ende 2013 nahmen Schweizer Institutionen an beiden Programmen direkt teil, sie hatten dieselben Möglichkeiten wie Partner aus den 32 anderen beteiligten Staaten. Während dieser Phase nutzten mehr als 16000 Studierende die Austauschmöglichkeiten Schweiz-EU, ungefähr gleich viele in beide Richtungen. Hinzu kamen viele Auslandspraktika. Die Mobilität der Studierenden und des Hochschulpersonals trug in der Schweiz wesentlich zur Internationalisierung des Tertiärbereichs sowie zum guten Funktionieren des Arbeitsmarkts und zum Wachstum der Wirtschaft bei. Zwischen 2011 und 2013 nahm die Mobilität in allen Sektoren zu. Schweizer Institutionen nutzten zudem die Möglichkeit, an Kooperationsprojekten teilzunehmen, um die Zusammenarbeit zwischen Hochschulen in ganz Europa zu stärken.
Mehr Infos und Fakten: www.europapolitik.ch
Newsletter abonnieren
Jetzt hier zum Newsletter eintragen. Wenn Sie sich dafür anmelden, erhalten Sie ab nächster Woche alle aktuellen Informationen über die Wirtschaftspolitik sowie die Aktivitäten unseres Verbandes.