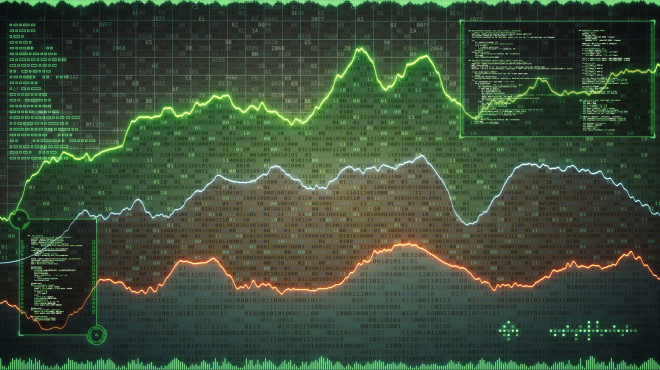Ist China schuld am Handelsbilanzdefizit der USA?
Das Handelsbilanzdefizit liesse sich eindämmen, wenn die Amerikaner weniger konsumierten und der Staat weniger ausgäbe. Doch weil die USA die globale Leitwährung halten, ist das gar nicht nötig.
Der Handelskonflikt zwischen den USA und China hält die Welt in Atem. Kürzlich hat Präsident Trump angekündigt, per 1. September auf alle noch nicht betroffenen Waren aus China einen Strafzoll von zehn Prozent einzuführen. Kurz darauf liess die chinesische Notenbank zu, dass der Wechselkurs des Renminbis zum Dollar die psychologisch wichtige Grenze von 7 überschritt. Trumps Reaktion liess nicht lange auf sich warten, er bezeichnete China als «Währungsmanipulator». Der Konflikt nimmt so immer gefährlichere Formen an.
Auf den ersten Blick mag man ein gewisses Verständnis für das Unwohlsein der Amerikaner angesichts des unausgeglichenen Handels mit China haben, denn in der Tat ist das Handelsdefizit der USA gigantisch. Sie exportieren jährlich Waren im Wert von rund 130 Milliarden Dollar nach China, importieren umgekehrt aber für rund 530 Milliarden. Schnell sind Erklärungen zur Hand: Chinas Währung sei gegenüber dem Dollar zu schwach, China würde die US-Importe benachteiligen und Exporte subventionieren. Nur deshalb sei die Bilanz derart unausgeglichen.
Würde man die Handelsbilanz stets auf null restringieren, wäre der freie Austausch von Gütern nicht mehr möglich.
Der Fokus auf die bilaterale Handelsbilanz ist aber aus drei Gründen problematisch. Erstens erfasst diese keine Dienstleistungen. Gerade die USA sind sehr gut darin, solche weltweit zu verkaufen, sei dies in Form von Investment Banking, Software oder Rechten an geistigem Eigentum. Zweitens kann die Bilanz leicht Verzerrungen enthalten, wenn Angaben des Ursprungslandes nicht korrekt sind oder Waren umfangreiche Vorleistungen aus anderen Ländern enthalten. So gilt ein iPhone, das in China montiert wird, an der Grenze als chinesisches Produkt, egal wie viel US-Know-how in der Entwicklung steckt.
Der dritte Grund ist grundsätzlicher Natur: In einer modernen arbeitsteiligen Welt gibt es Spezialisierung. Es ist daher völlig normal, dass Land A gegenüber Land B ein Handelsbilanzdefizit aufweist, während es mit Land C einen Überschuss erzielt. Das ist ein inhärenter Wesenszug der Globalisierung. Würde man die Handelsbilanz zwischen zwei Ländern stets auf null restringieren, wäre der freie Austausch von Gütern nicht mehr möglich. Stattdessen müsste man planwirtschaftliche Basare veranstalten und beispielsweise ein Flugzeug gegen Tonnen von Spielzeug tauschen oder Erdöl gegen Uhren. Spezialisierung, globale Wertschöpfungsketten und folglich auch eine effiziente Ressourcenallokation wären in der heutigen Form unmöglich.
Der Fokus auf die bilaterale Handelsbilanz führt deshalb zu falschen Schlüssen. Denn wenn die Vorwürfe an China zuträfen, müsste es einen gigantischen Aussenhandelsüberschuss mit der Welt insgesamt haben. Doch 2018 betrug er nur 0,4 Prozent des Bruttoinlandprodukts. Der Internationale Währungsfonds (IWF) zählt China deshalb nicht mehr zu den Verursachern globaler Ungleichgewichte. Ist gar der Renminbi nicht mehr schwach? Zwar ist die genaue Ermittlung des fairen Währungswerts mit Schwierigkeiten verbunden, doch die Entwicklung ist eindeutig: Gemäss dem IWF hat sich der Renminbi seit der Finanzmarktkrise bis heute real um etwa ein Drittel aufgewertet.
Die Dominanz des Dollars ist seit dem Zweiten Weltkrieg unangefochten.
Die Gründe für das Handelsbilanzdefizit der USA sind deshalb woanders zu suchen. Stellen sie sich vor, sie würden Monat für Monat mehr ausgeben als sie einnehmen, und ihre Schulden so stetig vergrössern. Es ginge nicht allzu lange, bis ihre Geldgeber nervös würden und sie ihr Verhalten ändern müssten. Was bei Privatpersonen gilt, gilt in der Regel auch für Staaten: Wenn sie über eine längere Zeit über die Verhältnisse leben, machen sich die Gläubiger Sorgen, ob die Schulden auch zurückgezahlt werden können. Die Zinsen steigen und zwingen die Regierungen, den Gürtel enger zu schnallen.
Doch die USA besitzen die globale Leitwährung. Der ehemalige französische Präsident Giscard d’Estaing soll einst von einem «exorbitanten Privileg» gesprochen haben. Fast zwei Drittel aller internationalen Reserven werden in Dollar gehalten. Gegen 90 Prozent aller Transaktionen auf den Devisenmärkten werden in Dollar abgewickelt. Die Dominanz des Dollars ist seit dem Zweiten Weltkrieg unangefochten. Weder der Euro noch der Renminbi können sie wirklich herausfordern. Das bringt es mit sich, dass die Finanzmarktteilnehmer Dollar halten, Staaten ihre Währung an den Dollar binden und in grossem Stil Dollar kaufen, wenn die eigene Währung zu stark zu werden droht. Der Dollar ist daher nicht nur die Währung der USA, sondern der ganzen Welt.
Der wahre Grund für das hohe Handelsbilanzdefizit ist also ein simpler: Weil die USA das exorbitante Privileg der globalen Leitwährung haben, können sie es sich leisten, jahrezehntelang mehr zu konsumieren, als sie sparen. Der Dollar bleibt stark, obwohl die Ausländer den amerikanischen Konsum finanzieren. In jedem anderen Land käme die Währung längerfristig unter Druck, denn das Aussenhandelsdefizit muss kompensiert werden durch Kapitalimporte, im Gegensatz zur Handelsbilanz muss die Zahlungsbilanz zwischen zwei Ländern ausgeglichen sein. Ausländer müssen also Willens sein, das Aussenhandelsdefizit der USA zu übernehmen. So finanzieren die Überschussländer die Defizite, indem sie amerikanische Staatsanleihen oder andere Vermögenswerte in den USA kaufen. Sie tun dies freiwillig, weil der Dollar unangefochten die globale Leitwährung ist.
Das hohe Handelsbilanzdefizit ist hausgemacht.
Das hohe Handelsbilanzdefizit der USA kann also nicht einfach China in die Schuhe geschoben werden. Vielmehr ist es hausgemacht. Die US-Konsumenten sparen zwar mehr als auch schon, aber mit rund sieben Prozent des verfügbaren Einkommens ungleich weniger als die chinesische Bevölkerung mit rund 36 Prozent. Zudem gibt der amerikanische Staat viel mehr aus, als er einnimmt. Auch die Steuersenkungen haben die Konjunktur angeregt. Eine niedrige Arbeitslosenrate und eine gut gehende Wirtschaft erhöhen nun die Nachfrage nach ausländischen Produkten.
Das Handelsbilanzdefizit liesse sich also ganz einfach eindämmen, indem die Amerikaner weniger konsumieren, mehr sparen und der Staat weniger ausgibt. Doch solange sie auf das exorbitante Privileg der globalen Leitwährung vertrauen können, ist das gar nicht nötig. Die Ausländer werden die Defizite noch lange finanzieren. Übrigens: Weitere Zinssenkungen des FED würden das Handelsbilanzdefizit kaum verringern. Zwar würde dies den Dollar etwas schwächen und die Exporte der USA verbilligen, doch niedrigere Zinsen stimulieren auch den Inlandkonsum und erhöhen so die Importe.
Hinweis: Dieser Beitrag ist am 31. August 2019 in der «Finanz und Wirtschaft» erschienen.