
Digitalisierung: Diese sieben Dinge braucht die Schule der Zukunft
Die digitale Transformation verlangt einen bildungspolitischen Wandel – und stellt künftige Arbeitskräfte vor neue Herausforderungen. Wir liefern sieben Lösungsansätze, wie das Schweizer Schulsystem den digitalen Wandel schafft.
Digitale Bildungspolitik: Worum geht es eigentlich?
65 Prozent der jetzigen Primarschülerinnen und Primarschüler werden später einen Job ausüben, den es heute noch nicht gibt. Es besteht daher dringender Handlungsbedarf im Klassenzimmer. Das Bildungssystem muss rasch angepasst werden. economiesuisse hat sieben bildungspolitische Forderungen zusammengestellt, damit unsere Kinder fit für die Zukunft sein werden.
Wo liegt das Problem?
Damit die Schweiz in Sachen Nachwuchs auf der Gewinnerseite der Digitalisierung steht, muss auch das Bildungssystem nochmals über die Bücher. Berufsprofile ändern sich ständig, spezifisches Fachwissen veraltet rasch. In Zukunft werden repetitive und physische Tätigkeiten abnehmen, kognitive und soziale Kompetenzen hingegen werden wichtiger.
Muss jeder ein «Techie» werden?
Nicht jedes Kind muss zum IT-Crack ausgebildet werden. IT-Wissen als Grundkompetenz wird aber wohl in den meisten Branchen vorausgesetzt werden. Es reicht nicht, der Schule einfach mehr Informatik zu verordnen. Die Mischung macht es aus. Im Grundsatz geht es vor allem darum, bei den Schülerinnen und Schülern Neugier zu wecken und sie einen positiven Umgang mit Veränderungen zu lehren. Zu diesem Zweck braucht es eine gute Mischung aus individualisiertem Unterricht und dem Unterricht in der Klasse zum Erlernen der immer wichtigeren Sozialkompetenzen.
Welche Fähigkeiten verlangt der Arbeitsmarkt der Zukunft?
Grundsätzlich steigen die Anforderungen an Arbeitskräfte – Anpassungsfähigkeit und Lernwille sind gefragt. Die Digitalisierung ist hierbei keine Bedrohung von Arbeitsplätzen, sondern eine Chance. Doch nicht das Bedienen von Maschinen wird wichtiger, sondern der Umgang mit Menschen. Wer im Arbeitsmarkt der Zukunft Erfolg haben will, muss künftig die folgenden vier Fähigkeiten mitbringen:
1. Vielseitige Kompetenz ist gefragt

Eine Konzentration auf gute Fachkompetenzen wird nicht ausreichen. Eine Arbeitskraft muss verschiedene Kompetenzen haben (Fach-, Handlungs-, Selbst- und soziale Kompetenzen). Oder anders ausgedrückt: Selbstdisziplin, Durchhaltewillen, Motivation, Teamfähigkeit, kritisches Denken, Urteilsvermögen oder Kreativität sind genauso wichtig.
2. MINT-Fächer müssen gefördert werden
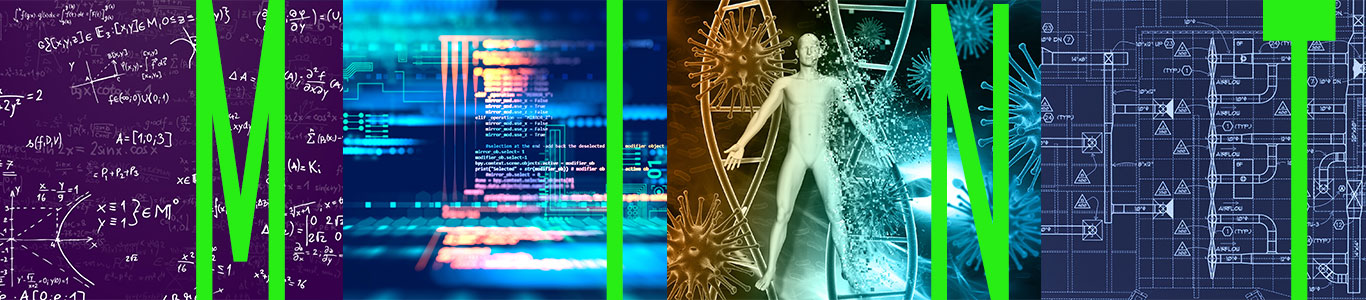
Komplexe Probleme zu lösen ist auch in Zukunft die gefragteste Kompetenz. Insbesondere Mathematik, Logik und Abstraktionsfähigkeit sind für eine steigende Anzahl Jobs zwingend. Deshalb braucht es in den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) mehr Abschlüsse.
3. Sozialkompetenz als Vorteil gegenüber Robotern

Die Bedeutung der «Soft Skills» wird zunehmen, da kein Roboter dies ersetzen kann. Maschinen übernehmen für uns quasi die lästige Arbeit – repetitive und physisch anstrengende Aufgaben beispielsweise.
4. Berufliche Mobilität und Flexibilität

Eines ist sicher, alles ändert sich. Die Arbeitskräfte der Zukunft überzeugen mit Durchhaltewillen und Bereitschaft zum lebenslangen Lernen. Diese Neugierde muss im Unterricht geweckt und von der Lehrkraft vorgelebt werden. Dementsprechend braucht es auch in der Ausbildung von Lehrinnen und Lehrern eine digitale Transformation.
Unsere sieben bildungspolitischen Forderungen
Damit unser Nachwuchs den gestiegenen Anforderungen gewachsen ist, muss das Klassenzimmer digitaler werden. Doch welche bildungspolitischen Anpassungen braucht es konkret, damit die Schweiz weiterhin starke Fachkräfte hervorbringt? Wir sind der Frage nachgegangen und haben sieben bildungspolitische Massnahmen erarbeitet:
1. Konzentration auf die wichtigen Grundlagen
vor allem Schulsprache und Mathematik. In diesen Fächern sollte der Unterricht individualisiert mit Softwareunterstützung erfolgen.
2. Computational Thinking
Schülerinnen und Schüler lernen, einen bestimmten Sachverhalt in einem Modell abstrahiert darzustellen, um ihn danach mithilfe von Algorithmen und Daten abzubilden («computational thinking»). Diese Fähigkeit ist entscheidend, um die Funktionsweise von Computern und digitalisierten Prozessen zu verstehen.
3. Informatik im Alltag
Schwimmen lernen muss man im Wasser. Alltagsanwendungen, vor allem der Umgang mit der Office-Software, sind nicht zu unterrichten. Informatik ist als Querschnittskompetenz zu betrachten, die in verschiedenen Fächern erlernt und eingesetzt wird.
4. Eigenständige Fortschritte
der Schülerinnen und Schüler unterstützen. Lehrkräfte müssen und können nicht länger überall bessere Kenntnisse haben als die Lernenden. Der zweckmässige Umgang mit der Digitalisierung im Unterricht erfordert von den Lehrerinnen und Lehrern also ein Umdenken.
5. Externe Expertise
Damit der Einzug der Informatik in den Unterricht nicht zu viel Zeit benötigt, können Kooperationen zwischen privaten Unternehmen und den Schulen zweckmässig sein. Heisst: Die Schulzimmer öffnen! Eine Lehrkraft muss nicht alleine alle Ziele des Lehrplans abdecken.
6. Entsprechende Kompetenzen an der Pädagogischen Hochschule vermitteln
Dies betrifft nicht nur die Lehrkräfte in Ausbildung. Auch die bereits aktiven Lehrkräfte müssen für die Digitalisierung fit gemacht werden.
7. «Soft Skills» nicht vergessen!
Damit die Jungen ein selbstbestimmtes Leben gestalten können, braucht es ein hohes Mass an Handlungs-, Selbst- und Sozialkompetenz. Zudem ist der Mensch auf der sozialen Ebene und in kontextabhängigen Fragestellungen den Computern überlegen.
Ist dies das Ende des analogen Klassenzimmers?
In der Schule hat die Digitalisierung also Auswirkungen auf die Didaktik und die Lerninhalte, aber auch auf die Pädagogik. Digitale Hilfsmittel werden sich durchsetzen, aber die Klassenzimmer werden deswegen nicht obsolet. Langfristiger Lernerfolg ist stark abhängig von sozialer Interaktion. Im Grundsatz geht es vor allem darum, bei den Schülerinnen und Schülern Neugier zu wecken und sie einen positiven Umgang mit Veränderungen zu lehren. Zu diesem Zweck braucht es eine gute Mischung aus individualisiertem Unterricht und dem Unterricht in der Klasse zum Erlernen der immer wichtigeren Sozialkompetenzen.
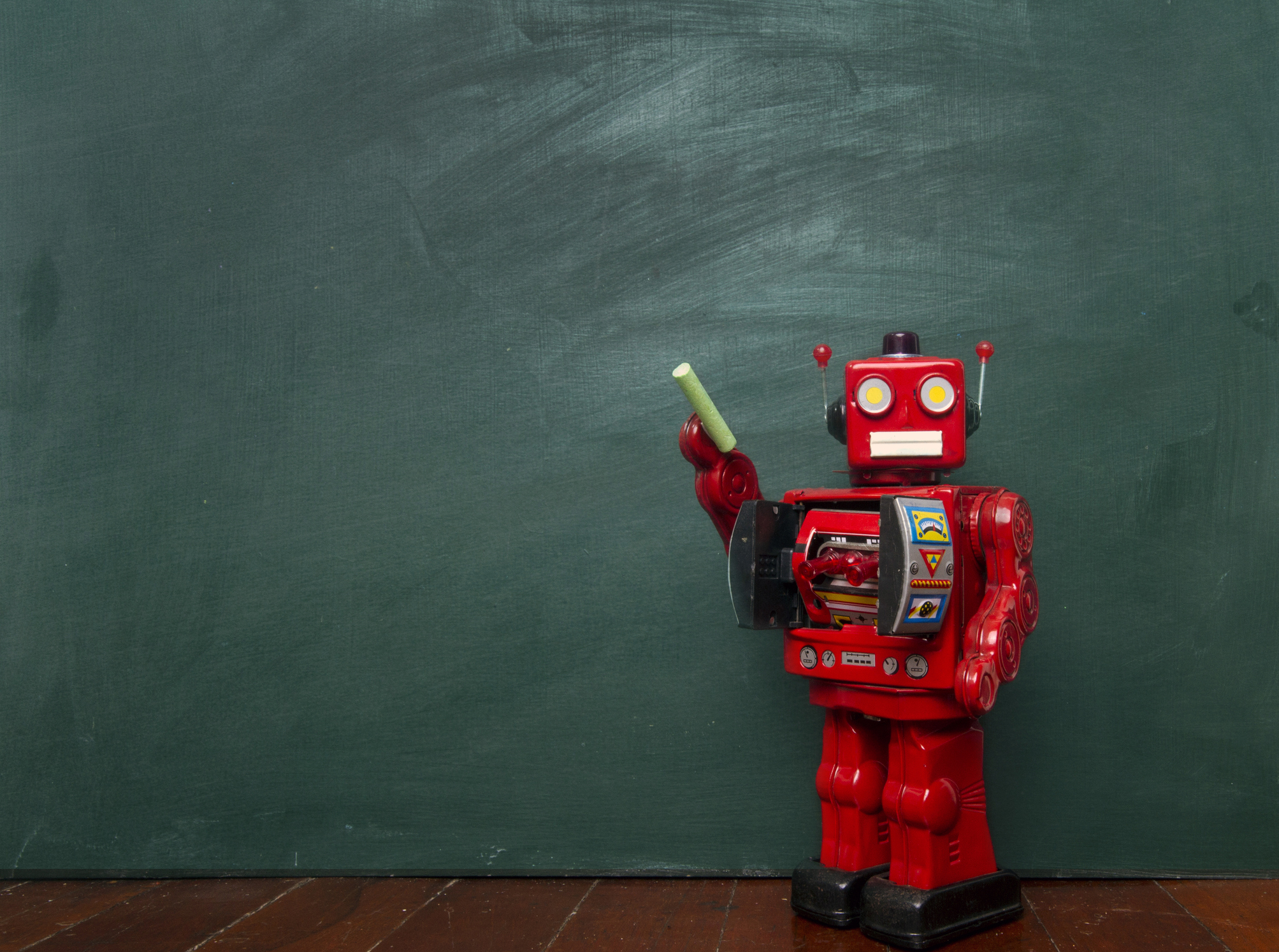
Mehr bildungspolitische Fakten gefällig? In unserem Dossierpolitik finden Sie weitere Hintergründe, Statistiken und Inhalte rund ums Thema Bildung und Digitalisierung zum Nachlesen.










