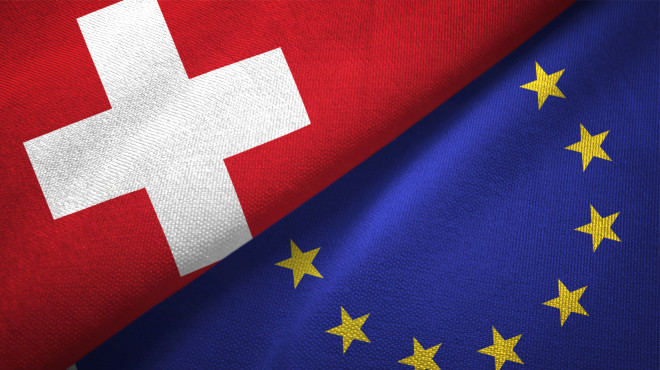Wie das Rahmenabkommen unsere Souveränität stärkt
Faktencheck Nr. 4 zum Rahmenabkommen: Die Gegner des Rahmenabkommens mit der EU behaupten, die Schweiz opfere mit einem solchen Abkommen ihre Souveränität und sei bereit, im Interesse der Grosskonzerne ihre Seele zu verkaufen. Eine genauere Betrachtung zeigt allerdings: Im Vergleich zur heutigen Situation würde ein Rahmenabkommen die Souveränität der Schweiz gegenüber der EU sogar stärken.
Behauptung: Durch das Rahmenabkommen verliert die Schweiz ihre Selbstbestimmung, das föderalistische System und die direkte Demokratie.
Tatsachen: Das Rahmenabkommen umfasst nur fünf Verträge aus dem Paket der Bilateralen I: Personenfreizügigkeit, Landwirtschaft, Land- und Luftverkehr sowie die gegenseitige Anerkennung von Produktzertifizierungen. Durch sie nehmen Schweizer Unternehmen und Bürger gleichberechtigt am europäischen Binnenmarkt teil. Damit dies möglich ist, müssen in der Schweiz dieselben Regeln gelten wie in der EU. Tatsächlich befolgt die Schweiz bereits seit 2002 die EU-Regeln in den Bereichen, welche von diesen fünf Abkommen abgedeckt werden. Dies hat nie zu nennenswerten Problemen geführt. Das Rahmenabkommen ändert an dieser Situation zunächst einmal nichts.
Allerdings verpflichtet das Rahmenabkommen die Schweiz, in Zukunft die Weiterentwicklungen des EU-Rechts in den von den fünf Verträgen umfassten Bereichen zu übernehmen. Eine Übernahme von EU-Rechtsvorschriften in nationales Recht würde aber auch in Zukunft immer nur unter Einhaltung unserer eigenen Rechtssetzungsverfahren erfolgen. Dafür gewährt das Rahmenabkommen der Schweiz jeweils eine Umsetzungsfrist von zwei Jahren. Wird gegen einen Gesetzesentwurf das Referendum ergriffen, erhält die Schweiz ein weiteres Jahr Zeit, um dieses durchzuführen. Der Rahmenvertrag respektiert somit das direktdemokratische System der Schweiz vollumfänglich.
Entscheidet die Schweiz jedoch, einen EU-Rechtsakt nicht zu übernehmen, muss sie mit den Konsequenzen leben: Die EU kann verhältnismässige Gegenmassnahmen ergreifen. Falls die Schweiz beispielsweise eine neue Richtlinie im Landverkehr nicht übernehmen will, kann die EU den freien Zugang von Schweizer Transportunternehmern in die EU einschränken. Die EU kann jedoch keine unverhältnismässigen oder sachfremden Gegenmassnahmen mehr treffen, so wie sie das momentan mit der Nichtanerkennung der Börsenäquivalenz tut – notabene ohne Rahmenabkommen.
Abgesehen von den fünf bestehenden und allen zukünftigen Binnenmarktabkommen greift das Rahmenabkommen nicht in das Schweizer Rechtssystem ein. Es greift nicht in die Steuerhoheit der Schweiz ein, berührt die Aussen- und Handelspolitik der Schweiz nicht, macht keine Vorschriften bezüglich Zivil- und Strafsachen, und auch das föderalistische System der Eidgenossenschaft wird nicht tangiert. Kurz: ausserhalb der Binnenmarktabkommen bleibt alles beim Alten.
Mit dem Rahmenabkommen wird die Souveränität der Schweiz sogar gestärkt: In Zukunft kann die Schweiz an der Ausarbeitung des sie betreffenden EU-Rechts mitarbeiten und dieses in ihrem Sinne beeinflussen.
Übrigens: Wussten Sie, welch bunte Blüten der Föderalismus in der EU manchmal treibt? Föderalismus und Subsidiarität gehören seit seiner Gründung 1848 zu den Grundprinzipien unseres Bundesstaates, und wir sind zu Recht stolz darauf. Auch unter den EU-Mitgliedern gibt es heute ausgesprochen föderalistisch aufgebaute Staaten wie Deutschland, Österreich oder Belgien. In Belgien ist der Föderalismus besonders ausgeprägt und führt manchmal zu erstaunlichen Resultaten. Die Souveränität der insgesamt sieben regionalen Parlamente geht so weit, dass sie sogar die Aussenpolitik der gesamten EU zu blockieren vermag. Als 2016 das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada ratifiziert werden sollte, mussten diesem erst noch die belgischen Regionalparlamente zustimmen, weil einzelne Teile des Abkommens in ihren Kompetenzbereich fielen. Erst nach zähen Verhandlungen mit der wallonischen Regionalregierung und dank innenpolitischen Zugeständnissen erwirkte die belgische Regierung die Zustimmung des wallonischen Parlaments, das gerade einmal 0,7 Prozent der Bevölkerung der EU vertritt. Dies wäre, wie wenn in der Schweiz für ein Freihandelsabkommen die Zustimmung aller 26 Kantone nötig wäre und der Kanton Zürich dem Abkommen nicht zustimmen könnte, weil das Stadtparlament von Winterthur seine Zustimmung verweigert.
FAKTENCHECK RAHMENABKOMMEN
In unserer Sommerserie «Faktenchecks zum Rahmenabkommen» sind bereits folgende Beiträge erschienen:
1. Uups! 60 Prozent des Stimmvolkes glatt vergessen
2. Dürfen wir nur noch im Sommer schwimmen?
3. Warum Angela Merkel nie Bundesrätin werden kann
5. Die Steuerhoheit der Kantone bleibt gewahrt
6. Rahmenabkommen stärkt Schweizer Bildungssystem
7. Lohnschutz bleibt Sache der Sozialpartner
8. Die Mär vom Tod der Kantonalbanken