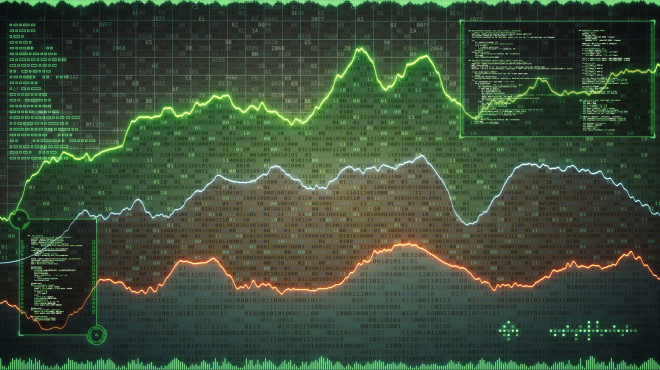Digitalisierung: WEF-Prognosen statt schwarz nun fast schon rosa
Erinnern Sie sich? Im vergangenen Jahr thematisierte das World Economic Forum (WEF) die Digitalisierung. Manche Analysten und Ökonomen überboten sich bei der Schätzung, wie gross der damit verbundene Arbeitsplatzabbau denn sein würde. «Bis zu 50 Prozent» lauteten die auf der Basis von Umfragen erstellten Prognosen. Ein Jahr später wird die Sache sehr viel nüchterner beurteilt, wie die aktuellen Studien des WEF zeigen.
Der Blick nach Amerika zeigt: Erstens wird der erwartete Arbeitsplatzabbau in allen Branchen der USA mit einer Ausnahme durch den Arbeitsplatzaufbau überkompensiert. Mit anderen Worten: In den USA sollten in den nächsten Jahren – bis 2026 – sehr viele Stellen neu hinzukommen, trotz oder gerade wegen der Digitalisierung. Meist werden parallel zum technologisch bedingten Abbau in derselben Branchen wieder neue Stellen geschaffen.
Wir haben für die Schweiz kürzlich eine Analyse mit ähnlichem Resultat durchgeführt: Innerhalb eines einzigen Jahres fallen auf dem inländischen Arbeitsmarkt rund zehn Prozent aller Stellen weg, doch ebenso viele werden gleichzeitig geschaffen. Die meisten dieser Stellen werden sogar in derselben Branche wieder aufgebaut. Der Arbeitsmarkt ist also sehr dynamisch, und technologische Entwicklungen, die sich über etliche Jahre hinstrecken, können so absorbiert werden.

Zweitens bildet die industrielle Produktion die Ausnahme. Hier werden für die USA bis 2026 insgesamt weniger Arbeitsplätze erwartet. In einer anderen Studie schätzt das WEF den durch die Digitalisierung zu erwartenden Stellenabbau in fünf Produktionsindustrien (Textil, Auto, Elektronik, Chemie, Industrieausrüstung) weltweit auf insgesamt 16 Prozent. Auch in diesen Industrien werden neue Jobs geschaffen, doch die Zahl reicht nicht aus, um die Verluste zu kompensieren. Dies ist aber nicht erstaunlich, denn die entsprechenden Produktionsprozesse sind weltweit noch sehr arbeitsintensiv und können durch die Digitalisierung effizienter gestalten werden. Auch hier lohnt sich der Quervergleich mit der Schweiz, die nicht mehr über viele solcher Arbeitsplätze verfügt. In unserem Hochlohnland ist eine arbeitsintensive Produktion kaum mehr möglich. Die vergangene Phase der Frankenstärke hat diese Sachlage noch verstärkt.
Bei einem starken strukturellen Wandel ist das lebenslange Lernen Pflicht, um arbeitsmarktfähig zu bleiben.
Drittens muss der Fokus auf die Weiterbildung gelegt werden. Bei einem starken strukturellen Wandel ist das lebenslange Lernen Pflicht, um arbeitsmarktfähig zu bleiben. Dies ist nicht nur im Interesse des Einzelnen, sondern auch im Interesse der Unternehmen. Denn der Kampf um Fachkräfte und Talente wird sich im Zuge der demografischen Entwicklung verschärfen.
Kurz: Trotz – oder wegen – der Digitalisierung werden auch in Zukunft mehr Jobs auf- als abgebaut. Um davon aber profitieren zu können, müssen wir alle am Ball bleiben.