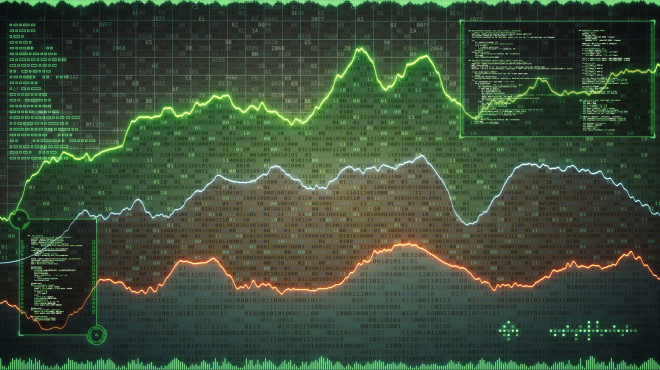Verhaltenes Wachstum unter Potenzial
Die wirtschaftliche Lage in den Exportmärkten hellt sich nur langsam auf. Die Exportwirtschaft leidet weiterhin unter der gedämpften internationalen Nachfrage. Insbesondere die Europäische Wirtschaft schwächelt. Die Schweizer Binnenwirtschaft hingegen wächst aber moderat. Für 2024 geht economiesuisse insgesamt von einem Wachstum des Schweizer Bruttoinlandprodukts (BIP) von 1,1 Prozent aus (unverändert). Das Wachstum wird sich 2025 leicht beschleunigen. Die Normalisierung des Arbeitsmarktes schreitet voran, wobei die Arbeitslosenquote mit 2,3 Prozent (2024) und 2,5 Prozent (2025) weiterhin unterdurchschnittlich bleibt. Die Inflation verharrt im Zielband der Schweizerischen Nationalbank.
Die Weltwirtschaft wächst nur gedämpft. Geopolitische Unsicherheiten, der Handelskonflikt zwischen den USA und China, die militärischen Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten verunmöglichen es, dass der Wachstumspfad solide und nachhaltig ist. Besonders in Europa, aber auch in Japan schwächelt die Wirtschaft. China wächst, allerdings weniger als in der Vergangenheit. Hier belastet neben dem Handelskonflikt vor allem die Immobilienkrise. Demgegenüber legt die Wirtschaft in den USA trotz hohen Zinsen erstaunlich robust zu. Die Kehrseite ist allerdings, dass die Inflation in den USA nicht so rasch auf die Zielgrösse von zwei Prozent zurückkommt. Die Dienstleistungspreise steigen vor allem aufgrund des Lohnanstiegs. Ähnliches ist auch in der EU zu beobachten, wenn auch hier die schwache Wirtschaftsentwicklung der letzten Quartale die Inflation rascher sinken liess. Insgesamt sieht sich die Schweizer Exportwirtschaft trotz schwächerem Franken mit einer verhaltenen internationalen Nachfrage konfrontiert. Gerade im Industriesektor halten sich viele Kunden zurück. Die Nachfrage wird zusätzlich dadurch belastet, dass Industrieunternehmen in unsicheren Zeiten ihre Lagerbestände abbauen, statt neue Vorleistungen zu bestellen.
Deutlich weniger ruppig geht es in der Binnenwirtschaft der Schweiz zu. Sie profitiert davon, dass die Inflation in der Schweiz schon wieder im Zielband der SNB liegt, von moderaten Zinsen und von einer tiefen Arbeitslosenquote. Der private und der öffentliche Konsum unterstützen dies. Trotz des kaum wachsenden Bauhauptgewerbes ist, die Auftragslage im Ausbaugewerbe deutlich besser. Vor allem die energetischen Sanierungen und Investitionen in die Gebäudetechnik sorgen für eine hohe Auslastung der Betriebe.
Mehrheitlich positive Aussichten
Die 2024 erfolgreichen Branchen erwarten auch für das nächste Jahr eine positive Entwicklung. Die Pharma- und die Medizinalgüterindustrie können sich weiterhin den konjunkturellen Widrigkeiten mehrheitlich entziehen. Banken und Versicherungen wachsen in diesem und nächsten Jahr stabil. Branchen, welche stärker von der internationalen Nachfrageschwäche betroffen waren oder sind, gehen meist davon aus, dass sich die Nachfrage in den kommenden Monaten wieder etwas erholt und blicken recht zuversichtlich ins nächste Jahr. Die Nachfrage nach Uhren in China sollte nach einem schwierigen ersten Quartal 2024 wieder ansteigen. Eine Beruhigung der Auftragslage zeigt sich auch in der Industrie. Der Lagerabbau, der in den vergangenen Monaten die Nachfrage reduziert hat, kommt zu einem Ende, und es ist davon auszugehen, dass wieder mehr Bestellungen eintreffen. Die derzeit von der Nachfrageschwäche in Europa stark belasteten Maschinen- oder Textilindustrie erreichen 2024 den Tiefpunkt und hoffen im nächsten Jahr auf eine Rückkehr zu Wachstum.
Binnensektoren weiterhin stabil
Der private Konsum stützt weiterhin die Konjunktur. Nach den Reallohnrückgängen der letzten zwei Jahren werden die Nominallöhne in diesem Jahr stärker steigen als die Inflation. Auch die anhaltende Zuwanderung erhöht den Konsum. Nachdem sich der Konsum der öffentlichen Hand nach der Pandemie normalisiert hat, wird er in diesem und im nächsten Jahr wiederum ansteigen. Die anhaltenden Unsicherheiten belasten aber das Investitionsverhalten. So nehmen die Ausrüstungsinvestitionen nur leicht zu. Bei den Bauinvestitionen setzt sich die Entwicklung fort: Das Bauhauptgewerbe wird durch langwierige Baubewilligungsverfahren ausgebremst, so dass weniger Wohnungen gebaut werden können. Immerhin legt der Tiefbau zu.
Die Beschäftigungsaussichten sind insgesamt nach wie vor gut. Es gibt mehr Firmen, welche die die Beschäftigungen erhöhen möchten, als sie zu reduzieren. Die Zahl der offenen Stellen hat sich zwar etwas zurückgebildet und die Arbeitslosenquote ist leicht angestiegen. Dennoch hält der Arbeitskräftemangel an. Insgesamt erwartet economiesuisse für dieses Jahr eine anhaltend tiefe Arbeitslosenquote von 2,3 Prozent und eine von 2,5 Prozent im nächsten Jahr.
Die Inflation ist noch nicht besiegt. International wird diese vor allem durch den Anstieg der Dienstleistungspreise bestimmt, während die Güterpreise mehrheitlich stabil sind. Im Gegensatz zu den USA oder der Euro-Zone liegen die Inflationsraten in der Schweiz, auch die Kerninflation, aber innerhalb des Zielbandes der SNB. Zwar ist der Zinsgipfel erreicht, doch die zähe Inflation in den USA und in der Euro-Zone macht starke Zinssenkungen in den nächsten Monaten wenig wahrscheinlich. Entsprechend wird es weiterhin ein recht grosses Zinsdifferenzial des Frankens zum Euro und zum Dollar geben. Dies führt dazu, dass der Franken kurzfristig eher zur Schwäche neigt. Die fundamentalen Faktoren wie Inflationsdifferenzial, Handelsbilanzüberschuss und gesunde Verschuldung der Schweiz sprechen aber für einen stärkeren Franken.
Konjunkturrisiken und Wachstumshemmnisse
Rund ein Fünftel der Umfrageteilnehmer nennt die geopolitischen Spannungen als grösstes Konjunkturrisiko (siehe untenstehende Tabelle). Kundenseitig droht im Krisenfall eine schwache Nachfrage oder eine zu geringe Investitionstätigkeit. Auch monetäre Faktoren (Inflation, steigende Energie- und Rohstoffpreise, Aufwertung Franken, steigende Zinsen) können die Konjunktur belasten. Das Wachstum der Schweizer Volkswirtschaft wird auch durch interne Faktoren gebremst: So gibt rund ein Zehntel der Umfrageteilnehmer an, dass die (Über-) Regulierung das Wachstum ihrer Firma restringiert. Auch der anhaltende Arbeitskräftemangel ist ein längerfristiges Hemmnis.
|
Konjunkturrisiko |
Prozent Nennungen |
|
Geopolitische Spannungen |
20% |
|
Schwache Nachfrage |
19% |
|
(Über-)Regulierung |
9% |
|
Energie- und Rohstoffpreise |
9% |
|
Arbeitskräftemangel |
7% |
|
Wechselkurs |
6% |
|
Inflation |
5% |
|
Geringe Investitionstätigkeit |
5% |
|
Ausländische Konkurrenz |
5% |
|
Steigende Zinsen |
4% |
Quelle: Umfrage economiesuisse Mai 2024, n=477
|
Prognosen Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung |
|||||
|
Veränderung gegenüber Vorjahr (%) |
|||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024P |
2025P |
|
|
Bruttoinlandprodukt, real |
5.4 |
2.7 |
0.7 |
1.1 |
1.4 |
|
Privater Konsum |
1.8 |
4.2 |
2.1 |
1.5 |
1.6 |
|
Öffentlicher Konsum |
3.3 |
-0.8 |
-2.0 |
0.6 |
0.8 |
|
Bauinvestitionen |
-3.1 |
-5.5 |
-2.0 |
0.0 |
0.2 |
|
Ausrüstungsinvestitionen |
6.0 |
4.6 |
-1.1 |
2.2 |
2.0 |
|
Exporte (Total)1 |
12.6 |
4.5 |
2.0 |
1.9 |
2.5 |
|
Importe (Total)1 |
5.9 |
5.9 |
4.5 |
2.4 |
2.6 |
|
1Ohne nicht monetäres Gold und Wertsachen |
|||||
|
|
|
||||
|
Prognosen Preise und Arbeitsmarkt |
|||||
|
Inflationsrate |
0.6 |
2.8 |
2.2 |
1.7 |
1.4 |
|
Arbeitslosenquote |
3.0 |
2.2 |
2.0 |
2.3 |
2.5 |
|
Exogene Annahmen* |
||
|
2024 |
2025 |
|
|
Wechselkurs CHF/Euro |
0.97 |
0.92 |
|
Wechselkurs CHF/$ |
0.90 |
0.85 |
|
Ölpreis in $ |
85 |
85 |
|
Wachstumsrate U.S. |
2.6 |
1.6 |
|
Wachstumsrate Euro-Zone |
0.7 |
1.4 |
|
Wachstumsrate China |
4.5 |
4.2 |
|
Kurzfristige Zinsen |
1.6 |
1.5 |
|
Rendite Bundesobligationen |
1.0 |
1.0 |
|
* Inputgrössen für die Schätzung der Konjunkturprognosen |
||