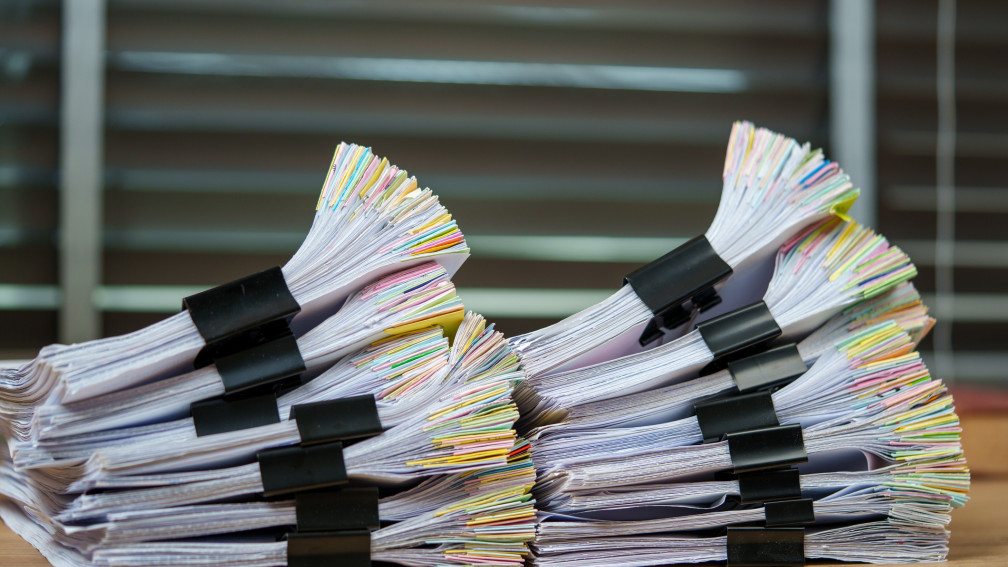Sammelklagen: Zweifel des Parlamentes werden von der Realität bestätigt
Die Rechtskommission hat bisher seit über zwei Jahren darauf verzichtet, auf die Sammeklagenvorlage des Bundesrates einzutreten. Nun bestätigt sich, dass es dafür gute Gründe gibt. Denn die Zweifel der Kommission waren berechtigt: gleich drei Entwicklungen zeigen auf wie gefährlich es wäre, mit solchen Instrumenten unser Rechtssystem nachhaltig zu beschädigen. Es ist daher sehr zu begrüssen, dass die Rechtskommission des Nationalrats diese Woche beschlossen hat, weiterhin nicht auf die Vorlage einzutreten.
Seit über zehn Jahren wird in der Schweiz über die Einführung von Sammelklagen diskutiert. Seit zwei Jahren berät die Rechtskommission des Nationalrats über die Einführung von erweiterten Verbandsklagen und Gruppenvergleichen. Sie ist nun diese Woche erneut nicht auf die Vorlage eingetreten. Stattdessen hat sie die Verwaltung damit beauftragt abzuklären, wie die Vorlage vor dem Hintergrund des kontroversen EGMR-Entscheides zu den Klimaseniorinnen zu sehen ist. Damit zeigt die Rechtskommission, dass sie ihre staatspolitische Verantwortung ernst nimmt und die grossen Risiken, die mit der harmlos daherkommenden Vorlage einhergehen, erkannt hat. Insbesondere drei Entwicklungen bestätigen die berechtigte Skepsis des Gesetzgebers.
1. Sammelklagen nehmen in Europa stark zu
Denkt man an Sammelklagen, denkt man vor allem an die USA. Dort sind diese Klagen stark verbreitet und eine professionelle Klageindustrie sorgt dort dafür, dass selbst für groteske Vorwürfe die Gerichte angerufen werden. Sammelklagen nehmen aber auch in Europa stark zu. Innerhalb von nur fünf Jahren hat sich ihre Zahl mehr als verdoppelt, vor allem in Ländern mit finanzkräftigen Unternehmen wie Grossbritannien und den Niederlanden. Dies sind alarmierende Zeichen. In der EU läuft sich die Regulierungsmaschine zur Eindämmung dieser negativen Entwicklungen gerade warm, eine Regulierung von Prozessfinanzierern und eine Regulierung von alternativer Konfliktbeilegung wird diskutiert.
2. Umfragen bestätigen: Die Schweizer Unternehmen wollen keine Sammelklagen
Der Bund hatte im letzten Herbst im Auftrag der nationalrätlichen Rechtskommission über das Forschungsunternehmen ecoplan eine Umfrage zur Betroffenheit der Wirtschaft durchführen lassen. Leider hat er es dabei unterlassen, die Umfrage neutral auszugestalten, weswegen sie von zahlreichen Unternehmen als einseitig kritisiert worden war. Man konnte sich bei dieser Umfrage lediglich zur Vorlage des Bundesrates und nicht zu Alternativen äussern, was die Ergebnisse verfälschte.
Im Vorfeld der parlamentarischen Beratungen hat das Forschungsinstitut Sotomo daher im Auftrag der Wirtschaftsverbände economiesuisse und Swissholdings eine Befragung bei knapp 90 Fachpersonen von Unternehmen durchgeführt. Dies mit dem Ziel, grundlegende Einschätzungen zu den Folgen eines Systemwechsels in Erfahrung zu bringen.
In wichtigen Punkten lassen beide Umfragen aber ähnliche Aussagen zu:
- Die Unternehmen erwarten erheblichen Kostendruck durch Sammelklagen. Je mehr Erfahrungen ein Unternehmen bereits mit Sammelklagen machte und je grösser es ist, desto grösser ist die Kritik am Instrument Sammelklagen.
- Gerade diese Unternehmen sprechen sich denn auch klar gegen die Einführung von Sammelklagen aus. Sie rechnen mit einer Zunahme von besonders öffentlichkeitswirksamen Gerichtsverfahren gegen Unternehmen in der Schweiz und damit verbunden auch grosse Reputationsrisiken.
- Die Unternehmen mit Erfahrungen mit Sammelklagen befürchten, dass der Druck auf die Unternehmen zunimmt, sich vorschnell auf einen Vergleich einzulassen. Darin werden sie auch durch die Entwicklungen im Ausland und die Zunahme von Sammelklagen bestätigt.
3. Die Politisierung der Gerichtssäle schreitet mit grossen Schritten voran
Dass Sammelklagen oder Klagen allgemeiner Art genutzt werden, um politische Anliegen zu verfolgen und am Gesetzgeber vorbei die Rechtsentwicklung zu prägen, ist nichts Neues. Der breit bekannte Fall der niederländischen Shell sei hier nur exemplarisch genannt, weltweit gibt es eine Vielzahlt von Klimaklagen gegen Staaten und Unternehmen. Ausgerechnet diese Woche hat nun der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) auch die Schweiz gerügt, weil sie zu wenig gegen die Klimaerwärmung unternehme und damit die Menschenrechte älterer Frauen verletze. Damit steht das ganze Land am Pranger. Angesichts der breiten Berichterstattung ist anzunehmen, dass nun nach Greenpeace – welche die Klage der Klimaseniorinnen orchestriert hatte – zahlreiche weitere NGOs auch versuchen werden, über Klagen vor Gerichten, statt über die demokratischen Volksrechte ihre Interessen durchzusetzen. Sammelklagen wirken hier als Brandbeschleuniger. Etwas pointiert formuliert kann man auch sagen: ein Gesetzgeber, der Instrumente wie Sammelklagen zulässt, riskiert, seine eigene Relevanz zu gefährden. Die Rechtsentwicklung würde vielmehr über die Gerichte und nicht mehr über das Parlament erfolgen.
Alternativen zu Sammelklagen sind verfügbar
Soweit Instrumente zur Durchsetzung von kollektiven Schäden geschärft werden sollen, so sind Sammelklagen der denkbar schlechteste Weg. Es gäbe effiziente und überlegene Alternativen wie Ombudsverfahren, technologische Mittel oder die Optimierung der bestehenden Klagetypen. Es wäre angemessen, dass sich der Bundesrat Gedanken macht, wie man hier vorankommt, statt an seiner veralteten Vorlage festzuhalten.
Die Wirtschaft wird angesichts der besorgniserregenden Entwicklungen weiterhin alles daran setzen, damit die Schwächen und insbesondere die Gefahr der bundesrätlichen Vorlage erkannt werden. Sie setzt darauf, dass die Kommission die Vorlage in ihrer nächsten Sitzung als unrettbar erkennt und endgültig zurückweist. Damit macht sie gleichzeitig den Weg frei für rechtstechnisch überlegene Instrumente ohne schädliche Nebenwirkungen.