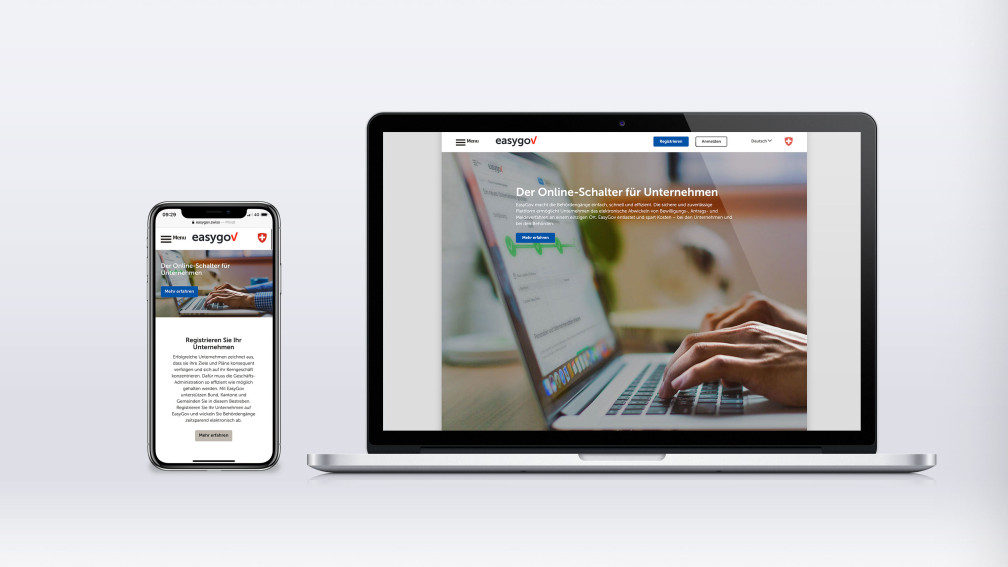Die Gesellschaft ist Treiberin des Wandels – die Digitalisierung beschleunigt ihn
Was vor Kurzem undenkbar war, ist heute Realität: Ein Fremder übernachtet in der eigenen Wohnung – gebucht über ein Onlineportal und ohne, dass man selbst zu Hause wäre. Anstatt ein Auto zu besitzen, teilt man eines mit fremden Personen. Die Normen der Gesellschaft verändern sich stetig und mit ihr die Basis für erfolgreiche Geschäftsmodelle. Technische Innovationen ermöglichen ihre Umsetzung. Ausserdem intensivieren sie den Strukturwandel und tragen so zum Wohlstand bei.
Vor 30 Jahren symbolisierte ein Auto Status, Pfarrer und Lehrer waren teils noch feste Autoritäten im Dorf und die Unternehmer politisierten am Stammtisch. Sie alle boten den Menschen Orientierung. Heute sind die Anzahl Likes auf Facebook, Tweets oder Kommentare unter Artikeln von Onlineplattformen ein Statussymbol. Das meine ich wertfrei. Schliesslich befanden sich gesellschaftliche Normen und Gewohnheiten immer im Wandel. So tiefgreifend und schnell schien er allerdings noch nie voranzuschreiten.
Veränderte Normen sind die Treiber von gesellschaftlichen Entwicklungen. Die technischen Entwicklungen – man nennt sie auch «Digitalisierung» – wirken als Katalysator. Denn die Technik schafft neue Möglichkeiten und trägt dazu bei, dass sich die Entwicklungen überhaupt umsetzen lassen.
Voraussetzung dafür, dass Positives entsteht, ist der Strukturwandel.
Dieser Katalysator macht nationale Grenzen zu einer Nebensächlichkeit. Die Transaktionskosten sinken. Produkte und Dienstleistungen erreichen die Menschen zielgerichteter als früher und sind somit schneller eine kritische Masse. Beispielsweise werden Lebensmittel für Allergiker oder Möbel und Kleider, die nicht mehr im Trend liegen, erschwinglich. Und etablierte Unternehmen erhalten neue Konkurrenz.
Natürlich setzen diese rasanten Entwicklungen auch gegenläufige Trends frei. Nationalstaaten gewinnen in der Bevölkerung an Bedeutung. Die «Landliebe» beispielsweise ist das auflagenstärkste Magazin der Schweiz. Am Ende des Tages ist diese globale, technische Entwicklung aber positiv: Die Schweiz ist so wohlhabend, wie es sich unsere Vorfahren nicht zu träumen wagten.
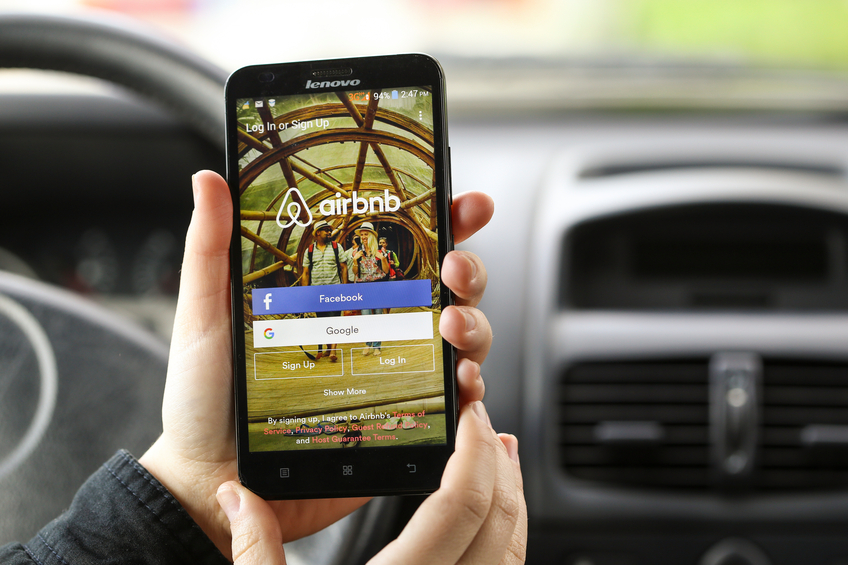
Voraussetzung dafür, dass Positives entsteht, ist der kontinuierliche Strukturwandel. Als offenes Land mit kleinem Heimmarkt haben wir grosse Erfahrung mit Strukturanpassungen. Hätte die Schweiz in den 1970er-Jahren an der damaligen Art der Maschinenproduktion festgehalten, wäre die Industrie verschwunden. Heute aber trägt sie noch immer einen Viertel zur Wertschöpfung der Schweiz bei.
Die Erfahrung zeigt: Nur wer die eigenen Stärken hinterfragt und lukrative Nischen findet, ist international wettbewerbsfähig. Der regulatorische Umgang mit den rasanten Entwicklungen muss sich dementsprechend an einer langfristigen und volkswirtschaftlichen Perspektive orientieren. Strukturen dürfen aufgebrochen werden. Verbote und der Versuch, technische Entwicklungen aus unserem Land zu verbannen, helfen niemandem: Weder den unter Druck geratenen Branchen noch den entsprechenden Geschäftsmodellen oder Arbeitsplätzen.
Zum Ziel kommt stattdessen, wer die wichtigen Grundwerte ergründet, die eigenen Stärken reflektiert und sich darauf konzentriert. Durch solche liberale Ansätze gehen die Schweiz und ihre Einwohner als Gewinner aus der «Digitalisierung» hervor.
Dieser Beitrag ist Teil unserer Artikelserie zur Digitalisierung. Lesen Sie nächste Woche über das Projekt «E-Verzollungsprozesse» der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV). Bereits erschienen:
- ICT-Infrastrukturen: Rückgrat einer digitalen Gesellschaft – Marcus Hassler über das Geheimnis schneller und sicherer Internetverbindungen.
- Daten als Treiber der digitalen Wirtschaft – Marlis Henze darüber, wie der rechtliche Rahmen für den Rohstoff «Daten» aussehen soll.
- Was ein Autokauf mit der Standortattraktivität zu tun hat – Erich Herzog fordert im Blog mehr Raum für internationale Selbstregulierung.